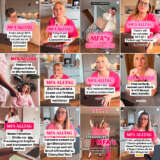Praxis mit PA
Hausarzt Florian Rau aus Harsefeld ist von seiner Physician Assistant begeistert – und die Patientinnen und Patienten auch

Foto: Praxis Rau
Dr. Florian Rau (43) studierte in Leipzig und Hamburg Medizin, ist Facharzt und Funktionsoberarzt für Viszeralchirurgie sowie für Allgemeinmedizin und seit Anfang 2023 Praxisinhaber der „Praxis im Zentrum“ in Harsefeld. Er beschäftigt zwei Physician Assistants in seiner Praxis.
Vor rund zwei Jahren ließ sich Florian Rau in Harsefeld westlich von Hamburg als Hausarzt nieder. Der gelernte Viszeralchirurg merkte schnell, wie viel Arbeit gerade im ländlichen Bereich in der Versorgung geleistet werden muss. Unterstützung musste also her. Gab es da nicht einen ärztlichen Assistenzberuf, den er bereits aus dem Krankenhaus kannte? Richtig. Vielleicht könnte eine Physician Assistent – kurz PA – seine Praxis bereichern. Also fragte Rau bei der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistent nach, und tatsächlich: Im Juni 2023 stieg eine ausgebildete PA in Raus Praxis ein und begann nach 14 Tagen Einarbeitungszeit ärztliche Aufgaben von ihm zu übernehmen. „Und das hat gut funktioniert“, sagt der Hausarzt. Also wurden die PA-Sprechstunden peu-á-peu ausgeweitet. „Anfangs betreute die PA Infekte, da die relativ einfach zu handhaben sind, später dann auch DMP oder Check-Ups“, berichtet Rau. Die PA bereitet vor, untersucht die Patienten und kommuniziert ihre Diagnosevermutung. Stimmen Arzt und PA überein, folgt die dahingehende weitere Diagnostik. Alles immer in Delegation. Rau sieht die Patienten natürlich weiterhin – auch schon aus Abrechnungsgründen – und trägt die medizinische Verantwortung, aber die PA nimmt ihm viel Arbeit ab. Die Reaktionen der Patientinnen und Patienten sind durchweg positiv. „Teilweise wollten Patienten gar nicht mehr zu mir, sondern explizit zur PA“, berichtet Rau.
Das Praxisteam hat er zuvor aufgeklärt und instruiert, damit die richtigen Aufgaben und nicht ureigene ärztliche an die PA übertragen werden. Berührungsängste mit der neuen und „besonderen“ Kollegin gab es keine; sie passt gut ins Team. Ist das Konzept PA also aufgegangen und die gewünschte Entlastung eingetreten?
Mehr Zeit für komplexe Fälle
„Viele sprechen von Entlastung, die steht für mich aber gar nicht so sehr im Vordergrund“, sagt Rau. Arbeitsentlastung gebe es vor allem bei den kleineren Sachen, um die er sich eben nicht mehr persönlich kümmern müsse. Den größten Benefit sieht der Hausarzt im Qualitätszuwachs für Komplexpatienten. „Für diese Patienten habe ich nun wesentlich mehr Zeit, kann mich stärker in diese Fälle vertiefen und eine passgenaue Behandlung durchführen. Das steigert die Patientenzufriedenheit und die Behandlungsqualität – das muss man einfach so sagen.“
Der höhere Verdienst eines PA ist für Rau okay. Gegenwärtig liegen die Verdienstmöglichkeiten unterhalb des Assistenzarztes und oberhalb des MFA-Gehalts. Problematisch ist für Rau etwas anderes: „Der PA ist gegenwärtig nicht querfinanziert und natürlich entstehen auch Leistungen in der Praxis, die über dem Budget liegen.“ Die fehlende Finanzierung schreckt Kolleginnen und Kollegen in anderen Praxen durchaus ab, PAs einzustellen, dennoch gibt es auch vereinzelt Nachfragen bei Rau. Aber: „Der Beruf ist insgesamt zu unbekannt und vielleicht fehlt auch noch das Vertrauen in das Berufsbild“, vermutet der Hausarzt. Dabei sieht Rau fast überall Einsatzbereiche, sowohl in Hausarzt- als auch in Facharztpraxen. „Wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen eklatanten Ärztemangel haben, gerade im ländlichen Bereich. Der PA ist bei der Lösung vielleicht nicht der Game-Changer, aber ein wichtiger Teil des Gesamtkonzepts. Gute PAs tragen auf jeden Fall zu einer verbesserten Versorgung bei.“ Von einem reinen Online-Studium hält Rau bei diesen Herausforderungen nichts. Doch bundesweit einheitliche Studiengänge gibt es noch nicht.
Fazit: Für Rau hat sich die Einstellung seiner Physician Assistant bereits gelohnt, mittlerweile sind sogar zwei in seiner Praxis beschäftigt. Und seine Patientinnen und Patienten wollen ebenfalls auf ihre PA nicht mehr verzichten.
Modellprojekt Physician Assistants
Physician Assistants (PA) können ein wesentlicher Stützpfeiler der ambulanten Versorgung sein – sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Das zeigen die Ergebnisse eines Modellprojektes, das die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) vor zwei Jahren gemeinsam mit der Hochschule für Gesundheit, Soziales und Pädagogik Rheine (EUFH) und der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistants e. V. (DGPA) auf den Weg gebracht hat. Das Zentralinstitut (Zi) für die kassenärztliche Versorgung stellt vorliegenden Abschlussbericht eine Entlastung der teilnehmenden Ärzte, eine hohe Akzeptanz im Praxis-Team und bei den Patientinnen und Patienten sowie eine gute Versorgungsqualität fest.
Alle Infos gibt es hier: www.zi.de
Das Berufsbild Physician Assistance (PA) ist ein medizinischer Beruf, der bereits seit 2005 in Deutschland angeboten wird und in den letzten Jahren auf immer mehr Nachfrage im Gesundheitswesen trifft. Die Deutsche Gesellschaft für Physician Assistants e.V. beschreibt den Beruf so: In einem Bachelorstudium erwerben Studierende breitgefächerte medizinische Kenntnisse. Von naturwissenschaftlichen Grundlagen, Anatomie, Physiologie und Pathologie über Innere Medizin, Chirurgie, OP-Lehre und Funktionsdiagnostik bis hin zu Public Health, Digitalisierung und Gesundheitsökonomie. Einige Hochschulen setzen den Abschluss einer dreijährigen medizinischen Ausbildung voraus. An anderen Hochschulen ist ein Studium primärqualifizierend möglich. Ein Masterstudium Physician Assistance wird seit 2021 angeboten. Jedoch schafft der Bachelorabschluss PA auch den Einstieg in einen Masterstudiengang einer anderen gesundheitlichen Fachrichtung bzw. Auslegung, zum Beispiel Krisen- und Notfallmanagement oder Digital Health.
Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung konkretisieren: Der Arzt überträgt dem PA delegierbare Aufgaben und wird so für seine Kernaufgaben entlastet und unterstützt. PAs übernehmen aufgrund ihrer hochschulischen Ausbildung die Begleitung komplexer Dokumentations- und Managementprozesse und organisatorischer Verfahren, können solche aber auch im Auftrag der ärztlichen Leitung mit entwickeln. Sie sind in der Lage, Ärzte in verschiedenen Tätigkeitsbereichen flexibel immer dann zu entlasten, wenn es sich nicht um höchstpersönlich vom Arzt zu erbringende Leistungen handelt.